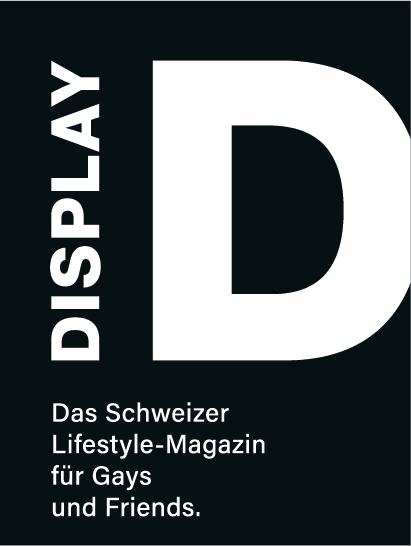Glühende Kohle, verwünschte Mühlen, treu liebende Diener: Die Märchen der Brüder Grimm sind ein Sammelbecken schwuler Symbolik. Davon ist Historiker Ueli Leuthold überzeugt. Seine Erkenntnisse stellen die Märchenforschung auf den Kopf. Jetzt gibt es sein Buch in einer kürzeren, leichter lesbaren Edition.
Schneewittchen und die sieben Zwerge – ein Märchen mit schwuler Symbolik? Die meisten würden mit einem Ja antworten. «Nein», sagt jedoch Ueli Leuthold, das sei Träumerei. Er muss es wissen, hat er sich doch gründlich mit den Märchen der Brüder Grimm beschäftigt. Dabei hat er aber herausgefunden, dass der Froschkönig und dessen Diener Heinrich schwul sind, so wie es wahrscheinlich auch die Brüder Grimm waren. Womit er diese Thesen stützt, erklärt er im Gespräch mit DISPLAY.
DISPLAY: Ueli Leuthold, Sie haben Grimm-Märchen analysiert und sind dabei auf umfangreiche schwule Symbolik gestossen. Warum ist Ihrer Ansicht nach der Froschkönig schwul?
Ueli Leuthold: Weil er die Königstochter nicht liebt – seinen Diener Heinrich jedoch schon. Er behandelt die Prinzession mit ausgesuchter Arroganz. Ihre Schönheit erwähnt er mit keinem Wort. Sie liebt ihn übrigens auch nicht. Nachdem er sich in einen Prinzen verwandelt hat, heisst es nur, seine Augen seien «schön» und «freundlich». Die Augen sind das Tor zur Seele. Es geht also um Seelenverwandtschaft; anziehend finden sie den Körper des anderen nicht. Zudem fürchtet der Froschkönig am Schluss, der Wagen, den sein Diener Heinrich lenkt und mit dem er mit der Königstochter in die Ehe fährt, könnte zusammenkrachen.
Wie deuten Sie das?
Es ist ein Hinweis darauf, dass die Gefühle des Froschkönigs für Heinrich so stark sind, dass seine Ehe in die Brüche gehen könnte.
Was weist sonst noch auf die amouröse Beziehung der beiden hin?
Weitere Symbole zeigen, dass sich der Froschkönig von Heinrich penetrieren liess. So wird betont, Heinrich «stehe hinten». Zudem wird der Frosch als schleimiges, Ekel erregendes Tier dargestellt. Von der Seite gesehen erinnert es an die männlichen Geschlechtsorgane. Das ist ein Bild dafür, dass der Froschkönig ein schlechtes Selbstwertgefühl als «passiver» Mann hat. Dieses möchte er durch Sex mit einer (ungeliebten) Frau überwinden. Hier wird also nicht eine Männerfreundschaft einer Ehe aufgepfropft – nein, eine Ehe wird mit Ach und Krach in die Partnerschaft zweier Männer eingefügt. Dazu passt, dass im Titel nur die beiden Männer genannt werden: «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich».
«Heinrichs Treue zum Froschkönig ist ein Code-Wort für die tabuisierte homosexuelle Liebe»
Trugen Sie bei Ihrer Forschung nicht einfach die pinke Brille?
Als Schwuler stutzt man bald. Nehmen Sie wieder den Froschkönig: Über den «treuen» Diener Heinrich erfährt man, dass er sich aus «Weh und Traurigkeit» eiserne Bande ums Herz legte, weil sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war.
Was sagt die klassische Forschung zu den schwulen Indizien?
Man hat riesige Probleme mit diesem Teil der Geschichte. Oft wird er weggelassen. Oder es wird behauptet, Heinrich müsste eine Frau sein. Spätestens bei diesem Gedanken ist es einem Schwulen klar, dass der Diener seinen Froschkönig liebt. Heinrichs Treue ist ein Code-Wort für die tabuisierte schwule Liebe. Sie erscheint in einem weiteren Märchen unter demselben Code-Wort. Weitere homosexuelle Symbole erscheinen in anderen Märchen: zum Beispiel heisse Kohle für Sex zwischen Männern oder die Mühle für Orte, an denen Männer miteinander Sex haben.
Das sind Ihre Interpretationen.
Natürlich, aber im Gesamtzusammenhang merkt man, dass sie stimmen. Und ich bleibe bei meinen Analysen Wort für Wort beim Text. Darum sind die Ergebnisse meines Erachtens klar. Man müsste umgekehrt fragen: Warum hat man bisher nicht gemerkt, dass es in vielen dieser Märchen um Homosexualität geht? Ich vermute, weil die Forscher hetero sind.
Sie vermuten, dass die Gebrüder Grimm selber schwul waren. Was deutet darauf hin?
Zum einen die seltsame Arbeits- und Lebensgemeinschaft, welche die beiden verband: Sie lebten fast immer in derselben Wohnung. Der eine heiratete mit 39, der andere nie. Damit will ich nicht andeuten, ihre Lebensgemeinschaft hätte Sex eingeschlossen – aber sie könnte auf einem gemeinsamen Geheimnis beruht haben.
Und zum anderen?
Die Brüder Grimm veränderten die Textvorlagen zu ihren Märchen stark. Ich habe alle diese Versionen miteinander verglichen. Ein paar ihrer Textveränderungen und -erweiterungen können in der damaligen – schwulenfeindlichen – Zeit fast nur von Schwulen stammen, so zum Beispiel der verhüllte Aufruf zu schwuler Solidarität am Ende eines der Märchen.
Sie analysieren 31 Märchen auf 800 Seiten. Da verlangen Sie von den Lesern einen langen Atem.
Die Analysen habe ich so geschrieben, dass man das eine oder andere Märchen, das einen interessiert, herauspicken kann. Man kann also auch Teile daraus lesen oder die Schlussfolgerungen am Ende – und dabei einiges erfahren. ||
Illustration: wista/toonpool.com
DER AUTOR
Sechs Jahre hat der Historiker Ueli Leuthold, 56, an seinem Werk geschrieben – die letzten zwei Jahre mit der linken Hand. Wegen eines erweiterten Blutgefässes im Hirn leidet er an einer chronischen Krankheit. Vor seiner Erkrankung war er Lehrer an einem Zürcher Gymnasium.

DAS BUCH
Von dem in der Märzausgabe des DISPLAY vorgestellten zweibändigen Werk von Ueli Leuthold über Homosexualität in den Märchen der Brüder Grimm ist nun eine leicht lesbare einbändige kürzere Fassung erschienen. Sie enthält auf 172 Seiten alles Wesentliche: Kurzfassungen aller 31 Märcheninterpretationen und ein abschliessendes Kapitel mit den zusammenfassenden Schlussfolgerungen. Zu empfehlen für alle, die sich für die Bedeutung der Grimm’schen Märchen interessieren. Ueli Leuthold: Von Coming Out, Gay Pride und Stiefkindadoption. Männliche Homosexualität in den Märchen der Brüder Grimm.