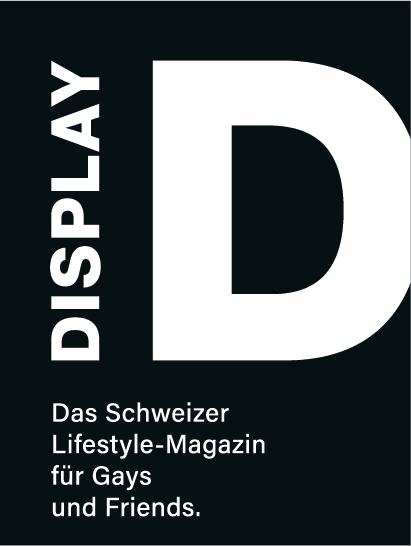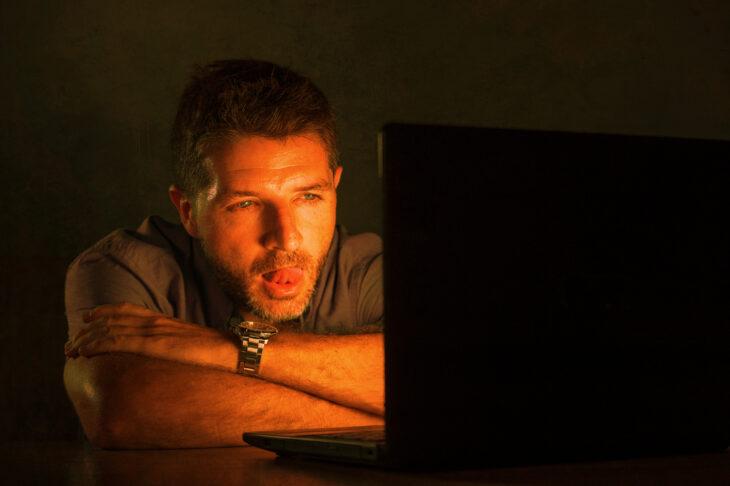Nur noch einen, noch den, wirklich nur noch den hier: Viele Männer vergessen sich beim Gucken von erotischen Videos – und haben danach ein schlechtes Gewissen. Stets und meist kostenlos verfügbar, können die Filme zu einer Verhaltenssucht führen, zu der Mann ungern steht: zur Pornosucht.
Von Marcel Friedli-Schwarz
Kein Tag ohne Pornos: Zwischen zwanzig und dreissig schaut Alex jeden Tag. «Am liebsten Amateurpornos. Je echter, je realer – desto krasser. Ich dachte, das ganze Leben sei ein Swingerclub», sagt er in einer Sendung der Mediathek des ersten deutschen Fernsehens.
Alex verfolgt nicht in erster Linie das Ziel, zum Höhepunkt zu kommen: «Vielmehr wollte ich möglichst lange auf der Adrenalin-Dopaminwelle reiten», sagt der Mittdreissiger. «Kaum hatte ich einen Orgasmus, fing ich wieder an. Weil ich das wieder haben wollte. Wieder und wieder und wieder. Stundenlang ging das. Nächtelang. In meinen Synapsen eingebrannt ist es, diese Glücksgefühle wieder und wieder erhalten zu wollen.»
Nur noch den geilen Chat im Kopf
Alex lebt in einer Wohngemeinschaft. Dass er sich in seinem Zimmer verbarrikadiert, fällt seinen Gschpänli zwar auf, doch sie wagen nicht, ihn darauf anzusprechen. «Ich war sozial nicht mehr kompatibel, führte mein Eigenleben: Ich hatte immer den nächsten geilen Chat und die kommende Cam-Session im Kopf. Und in mir den unterbewussten Schulterklopfer, der alles legitimiert und kleingeredet hat.»
Gesehenes versucht Alex in sein Leben zu übertragen. Dabei macht er die Erfahrung, dass es eine krasse Diskrepanz zwischen echtem Leben und erotischer Fantasiewelt gibt. «Zum Beispiel schaute ich mir wochenlang Natursekt-Pornos an. Als ich das im echten Leben ausprobierte, empfand ich dies jedoch als unangenehm.»
Die grosse Liebe war am Zerbröseln
Jahrelang düst Alex gewissermassen auf einer Autobahn, auf der er immer schneller fährt und sich einredet, dass der Tacho immer dieselbe Geschwindigkeit zeigt. Es droht ihn herauszuspicken.
Dann der Wendepunkt, den der Musiker so beschreibt: «Ich schaute meine Gitarren an. Und fühlte überhaupt nichts. Ich hatte null Lust, darauf zu spielen, Songs zu komponieren, so wie ich das vorher getan hatte. Es ging überhaupt nichts mehr. Die Liebe zu dem, was mir in meinem Leben am wichtigsten ist, war am Zerbröseln: meine Liebe zur Musik.»
In diesem Moment prallt Alex mit dem Kopf gegen eine Wand, taumelt und reibt sich danach die Augen: der Moment, als er sich eingesteht, dass ihn diese Autobahn ins Verderben führt.
Darum sucht Alex Informationen zu seiner Sucht, tauscht sich mit anderen Betroffenen aus. Das führte ihn auf den neuen Weg. «Zwar schaffe ich es nicht, ganz ohne Pornos zu leben. Hie und da habe ich Rückfälle. Schwierig ist es, der Weg ist lang», sagt er. «Ich werde wohl immer süchtig sein. Das scheint in meinen Synapsen eingebrannt.»
Bist du süchtig nach Pornos?
- Unter anderem folgende Punkte deuten darauf hin:
- Frustrationen, Leere, innere Spannungen oder Müdigkeit kompensierst du, indem du Pornos anschaust.
- Nachdem du Pornos angeschaut hast, fühlst du dich schlecht oder schuldig. Trotzdem suchst du neue.
- Du überprüfst ständig, ob auf den einschlägigen Websites neue Inhalte verfügbar sind.
- Die dargestellten Szenen müssen immer extremer werden, um die gleiche Lust zu spüren.
- Du bist weniger leistungsfähig, weil du (zu) viel Zeit – auch in der Nacht – mit Pornos verbringst.
Quelle: Zentrum für Spielsucht und andere Süchte Radix; spielsucht-radix.ch
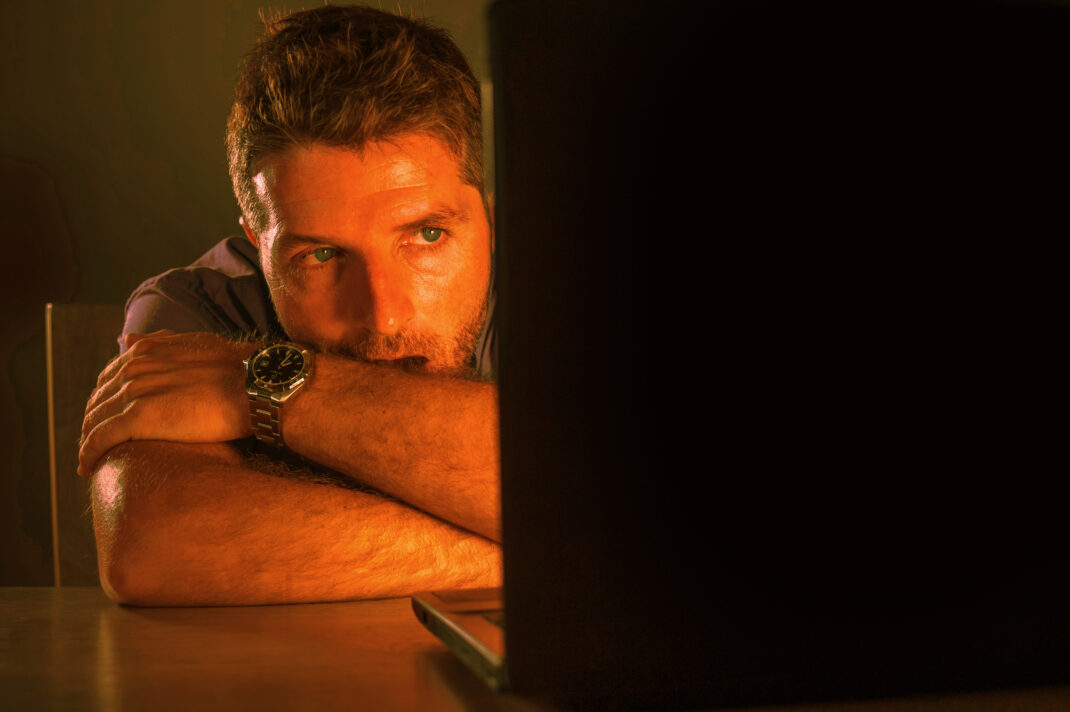
Mit ein paar Klicks
Mit dem Handy, dem Tablet, dem Laptop oder via PC: ein paar Klicks – und man ist auf einer Pornoseite. Gleich zwei solcher Sites gehören gemäss der Auswertung einer IT-Analysefirma zu den zwanzig meistgesuchten in der Schweiz.
Wie bei Alex beginnt die Sucht meist früh: Bereits mit neun Jahren hat jedes zehnte Kind schon einen Porno geschaut; bei 18-Jährigen sind es acht von zehn. Dies ist einer Studie zu entnehmen, die sich auf England bezieht. Die Zahlen gelten wahrscheinlich in etwa auch für die Schweiz.
Pornosucht ist eine Verhaltenssucht: Man(n) ist süchtig danach, etwas zu tun; also nicht süchtig nach Substanzen wie Alkohol, Kokain etc. Zu den Verhaltenssüchten gehören Spiel-, Arbeits-, Kaufsucht – mit ähnlich dramatischen Auswirkungen und Konsequenzen für das eigene Leben und auf jenes von Menschen, die einem nahe sind.
Die Problematik hat man auch in der Politik erkannt. So fordert Nationalrat Nik Gugger in einer Motion Massnahmen, mit denen Kinder mit technischen Vorkehrungen vor pornografischen Inhalten im Netz geschützt werden sollen. Der Nationalrat hat diese Vorlage angenommen. Sagt auch der Ständerat Ja dazu, werden die entsprechenden Massnahmen in die Wege geleitet. Der Bundesrat jedoch erachtet es als schwierig, das Verbot über die Schweizer Grenzen hinaus durchzusetzen und ist gegen den Vorstoss.
«Eine Form der Flucht»
Pornosucht ist ein doppeltes Tabu. Was damit gemeint ist und warum wir unbedingt darüber sprechen sollen: Das verrät Experte Domenic Schnoz im DISPLAY-Interview.
Interview Marcel Friedli-Schwarz
DISPLAY: Haben Sie selber schon Pornos geguckt?
Domenic Schnoz: Sicher. Wahrscheinlich hat das jede:r schon einmal gemacht.
Wie oft?
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist privat.
Ihre Aussage zeigt, wie schambehaftet und tabuisiert dieses Thema ist.
Nein. Ich finde, das ist nicht von öffentlichem Interesse. Im privaten Kreis würde ich es sagen. Ich erzähle ja auch nicht jedem, wieviel Geld ich auf dem Konto habe.
Geld ist auch ein Tabu.
Geld gehört meiner Meinung nach auch zur Privatsphäre. Doch Sie haben Recht: Pornosucht ist ein Tabu – ein doppeltes.
Ein doppeltes?
Sucht ist tabuisiert. Und Porno sowieso. Fast alle machen es, aber niemand spricht darüber. Wobei es wahrscheinlich noch schwieriger ist zu sagen: Ich schaue so viel Pornos, dass mein Leben bachab geht. Als: Ich habe ein Problem mit Alkohol.
Was kann man dagegen tun?
Wir setzen uns sehr dafür ein, dass man – offen und ohne zu verurteilen – darüber sprechen kann, wenn Pornokonsum zum Problem wird. So wird die Thematik bewusst und Betroffene holen sich eher Hilfe.
Rund drei bis sechs Prozent der Menschen in der Schweiz sollen süchtig nach Pornos sein – wie verlässlich sind solche Zahlen?
Diese Zahl ist mir nicht bekannt. Meines Wissens gib es für die Schweiz keine verlässlichen Zahlen.
Gibt es für andere Länder seriöse Angaben?
Zum Beispiel für Australien. Einer repräsentativen Studie kann man entnehmen, dass sich 4,2 Prozent der Männer und 1,2 Prozent der Frauen als pornosüchtig bezeichnen.
Menschen, die dazu stehen, dass sie (zu) viele Sexvideos schauen, sind rar. Warum sprechen wir nicht offen darüber?
Sexualität ist grundsätzlich schambehaftet, auch wenn die Gesellschaft offener geworden ist. Zudem schämen sich die meisten Betroffenen dafür, süchtig zu sein: Sie haben Angst, als jemand zu gelten, der sich anscheinend nicht im Griff hat und dem es an Wille und Selbstdisziplin fehlt.
Kann es auch Teil des Reizes und damit der Sucht sein, dass man Pornos im Versteckten schaut?
Das kann sein. Meist ist sie aber vor allem ein Symptom für etwas, das aus der Balance geraten ist. Dahinter können sich Ängste oder depressive Verstimmungen verbergen. Übermässig Pornos zu schauen, ist häufig eine Form der Flucht: Man will unangenehme Gefühle zur Seite drücken. Meist hat die Sucht eine Funktion und deutet auf ein anderes Thema hin.
Also nicht unbedingt darauf, dass die eigene Sexualität unerfüllt ist?
Das kann ein Grund sein. Ich denke aber, dass es meist nicht der zentrale ist. Wenn man sich etwas anschaut, das man in der Realität nicht lebt, muss das nicht automatisch zur Sucht führen.
Wann wird es zur Sucht?
Wenn man unter dem Verhalten zu leiden beginnt, es aber nicht zu stoppen oder zu reduzieren vermag. Betroffene suchen oft stundenlang im Internet nach einem spezifischen Inhalt, auf der Suche nach dem noch grösseren Kick. Andere Interessen und Bedürfnisse rücken in den Hintergrund.
Dass etwas nicht stimmt (siehe «Bist du süchtig nach Pornos?», Seite 73), fällt dem Umfeld meist auf. Ist es sinnvoll, mit einem Süchtigen das Gespräch zu suchen?
Ja. Vor allem soll man dies einfühlsam machen, ohne Vorwürfe.
Sagen, was einem auffällt und dass man sich Sorgen macht. Allenfalls Hilfe anbieten. Geht man das aber zu forsch an, kann man viel kaputt machen.
Wenn schon viel kaputt ist, finden Betroffene meist nur schwer wieder den Absprung – sind Sie optimistischer?
Eher realistisch: Will man wirklich, dann findet man den Weg aus der Sackgasse. Am besten geht das, wenn man sich bei Fachpersonen Hilfe holt. Der erste Schritt: sich eingestehen, dass man ein Problem hat.

Domenic Schnoz leitet das Zentrum für Spielsucht und andere Süchte, zu denen die Pornosucht zählt. Der 48-Jährige ist ausgebildeter Soziologe, Vater zweier Kinder und hat Freunde, die schwul und bisexuell sind.