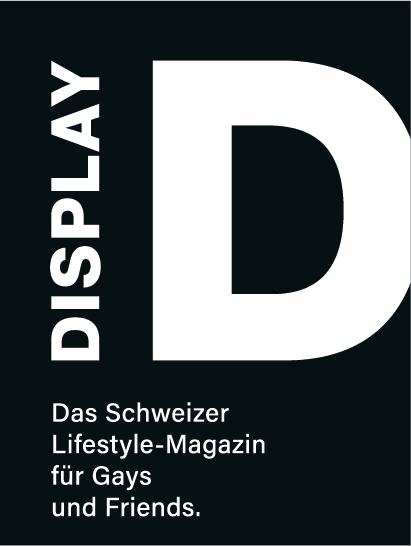Vor einem Jahr wurde Patrick Hässig in den Nationalrat gewählt. Wie ist es dem schwulen GLP-Politiker in Bern ergangen? Trifft er sich im Bundeshaus mit anderen queeren Volksvertreter:innen und wie hat sich seine Beziehung zu seinem Mann im letzten Jahr entwickelt?
Von Mark Baer
Die meisten kennen ihn noch als Moderator bei Energy Zürich, SRF 3 oder Radio 24. Eine Zeit lang moderierte er am Schweizer Fernsehen auch eine Quiz-Show, bis er ein Studium zum Diplomierten Pflegefachmann startete und durch seine Medien-Popularität zum bekanntesten Pflegefachmann der Schweiz avancierte.
Erst vor drei Jahren zog es Hässig dann aktiv in die Politik: er wurde Zürcher Stadtparlamentarier, ein Jahr später 2023 gelang ihm auch der Sprung ins Kantonsparlament, um im gleichen Jahr auch Bern zu erobern. Die Wahl als eidgenössischer Parlamentarier gelang Hässig nicht auf Anhieb. Bei den Wahlen im Herbst 2023 landete er auf dem ersten Ersatzplatz der Grünliberalen Partei. Weil seine Kollegin Tiana Moser es in den Ständerat schaffte, konnte der queere Neopolitiker dann doch noch (ohne Federboa) in den Nationalrat nachrücken.
DISPLAY: Grüezi Herr Nationalrat; wie oft hörst du das heute jeweils und hast du dich an diese Bezeichnung schon gewöhnen können?
Patrick Hässig: Grüezi Herr Baer, danke für die Einladung zu diesem Gespräch. «Herr Nationalrat» höre ich nun tatsächlich regelmässig. Dies jedoch vor allem bei öffentlichen Anlässen, Podiumsgesprächen oder wenn ich zum Beispiel jemandem vorgestellt werde.
Obwohl du mindestens zehn Jahre jünger ausschaust, kann ich mir vorstellen, dass einen die Anrede «Herr Nationalrat» doch gleich etwas älter macht, oder nicht?
Dass die Leute uns so ansprechen, hat nicht viel mit dem Alter zu tun, wie ich feststellen musste. Aber Danke fürs Kompliment. Trotzdem ist die Bezeichnung für mich immer noch speziell.
«Man kennt sich im Bundeshaus und weiss, wer sich für queere Anliegen einsetzt»
Behandeln dich die Leute in deinem Umfeld nun aber irgendwie anders, seit du ein gewählter Volksvertreter bist?
Nein, zum Glück nicht. Das soll bitte auch so bleiben!
Dann würde mich jetzt natürlich interessieren, wie das erste Jahr als Nationalrat war für dich?
Sehr, sehr spannend. Die Lernkurve ist enorm steil. Man wird ab Tag eins in alle Prozesse voll eingebunden, ohne eine Anlauf-phase zu haben. Die Geschäfte, Sitzungen und Prozesse laufen, weshalb es hier aufzuspringen gilt. Dies hat bei mir schon auch einen gewissen Druck ausgelöst. Als Nationalrat muss man abliefern. Nach der ersten Session bin ich nach Hause gekommen und war total «geflasht», was ich nach so kurzer Zeit schon alles erleben durfte.
Gibt es Dinge, die du dir anfangs anders vorgestellt hast?
Ich bin positiv überrascht, wie respektvoll miteinander umgegangen wird im Bundeshaus. Was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, erscheint einem oft als eine Art «Polit-Entertainment». Ich erachte es jedoch als grosse Stärke, dass man in unserem Land unterschiedliche Meinungen und Argumente haben kann, sich als Politiker:in danach aber wieder die Hand gibt, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Durch unser direktdemokratisches Polit-System dauern unsere Prozesse zwar lang, jedoch werden sie schliesslich durch Volksabstimmungen von der Bevölkerung getragen. Das ist viel Wert. Dieser Polit-Kultur gilt es unbedingt Sorge zu tragen.
Welches ist dein grösster Erfolg, den du als Politiker in Bern erreichen konntest?
Mir ist es gelungen, die Thematik der Spitalplanung in unserem Land neu anzustossen. Unser föderalistisches System kommt, wenn es um das Gesundheitswesen geht, an seine Grenzen. Insbesondere, wenn jeder Kanton «nur» für sich schaut. Die Spitalplanung übersteigt aber nachweislich die Kraft der Kantone. Deshalb soll der Bund hier ebenfalls Kompetenzen und Verantwortungen erhalten. Meine Forderung für «Bundeskompetenzen in der Spitalplanung» wird nun landauf, landab diskutiert. Das freut mich sehr.
Welches ist der grösste Frust «so far» für dich?
Zum Glück gab’s noch keinen wirklich grossen Frust. Was mich hingegen immer wieder stört ist, dass gewisse politische Lager kaum von ihrer Position abrücken und das Vorwärtskommen so blockieren.
Du sagst, dass deine Lernkurve in Bern steil gewesen ist. Welche Dinge hast du am schnellsten gelernt?
Dass es in der Politik Zeit und Geduld braucht. Das ist nicht meine Stärke, aber ich arbeite daran. Weiter durfte ich auch lernen, dass es in der Politik Momente gibt, um zuzuschlagen. Hat man den richtigen Moment verpasst, kommt er nicht wieder. Solche Augenblicke zu spüren und dann sofort zu handeln, ist wichtig als Nationalrat.
Was hast du dir für dein zweites Jahr als Volksvertreter vorgenommen?
Mich weiter in die verschiedenen Dossiers einzuarbeiten. Das braucht viel Zeit. Ein Jahr ist kein Jahr. Die ersten zwölf Monate sind schnell vorbeigezogen. Die Informationsdichte ist riesig. Wissen ist Macht. Je besser und sattelfester man ist, desto sicherer fühlt man sich in der Arbeit. Das ist mein Ziel für mein zweites Jahr in Bern.
Macht man sich bei jeder politischen Entscheidung Gedanken, ob man 2027 wohl wiedergewählt werden wird oder nicht?
Nein. Ich mache mir bei jeder politischen Entscheidung die Gedanken, ob sie zu mir passt und meinen Wertekompass widerspiegelt. Man kann jedoch nicht in allen Dossiers und politischen Fragen bis ins letzte Detail Bescheid wissen. Da verlässt man sich logischerweise auch mal auf die Argumente und Empfehlungen der Partei-«Gspändli».
Wie viel Prozent setzt du heute für die politische Arbeit ein?
Etwa 70 Prozent. Obwohl dies schwierig zu eruieren ist. Ich merke, dass dieses Nationalrats-Mandat täglich präsent ist. Abstellen kann man es nicht. Mit Mails beantworten, Telefongespräche führen, Sitzungstermine und Anlässe wahrnehmen und mit Einlesen in die verschiedenen Vorlagen, kann man seine Agenda nahezu täglich füllen.
Wie oft bist du noch im Zürcher Stadtspital Triemli?
Ich bin 30 Prozent als Pflegefachmann auf dem Kindernotfall tätig. Das passt so für mich. Das Stadtspital Zürich und ich haben einen guten Deal für beide Seiten: Ich darf sagen, an welchen Tagen ich arbeiten kann. Die Stationsleitung entscheidet dann, in welcher der drei Schichten ich an diesen Tagen zu arbeiten habe.
Vermisst du das Radiomachen oder sprichst du als Milizpolitiker heute inzwischen noch mehr in Mikrofone als früher?
Manchmal wäre es schon lässig, mal wieder die Radiohebel zu bewegen. Die Musik in den Ohren zu spüren, die Menschen durch den Tag zu begleiten. Es war eine tolle Zeit, die ich definitiv nicht missen möchte. Den Schritt, nach 18 Jahren aber eine andere Berufskarriere einzuschlagen, bereue ich bis heute nicht. Und ja, die Mikrofone gibt es tatsächlich auch heute wieder…

Gibt es eine queere Fraktion im Bundeshaus?
Patrick, gibt es eigentlich so etwas wie eine queere Fraktion im Bundeshaus, wo man sich regelmässig trifft?
Es gibt viele queer-freundliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ebenfalls gibt es die parlamentarische Gruppe LGBTIQ+. Diese führt in unregelmässigen Abständen Treffen durch. Regelmässige Kaffee-«Kränzli» oder Bier-Abende gibt es jedoch nicht.
Triffst du dich abgesehen von dieser Gruppe auch sonst ab und zu mit queeren Nationalrät:innen?
Man sieht sich während der Sessionen täglich im Bundeshaus. Man kennt sich und weiss, wer sich für queere Anliegen einsetzt. Ich hatte zum Beispiel schon Gespräche mit Mitgliedern der «Queer Officers», dem Verein von und für die queeren Angehörigen der Schweizer Armee.
Hast du jemals gespürt, dass dich gewisse Leute im Bundeshaus anders anschauen oder behandeln, weil du gay bist?
Nein. Das ist absolut kein Thema.
Welche Geschäfte, die für homo-, bisexuelle und trans Menschen wichtig sind, stehen in den nächsten Sessionen an?
Gerade als Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission ist es mir wichtig, dass nach den Ergebnissen der Studie über sexualisierte Gewalt in der Armee dort jetzt stark hingeschaut wird. Es besteht wirklich Handlungsbedarf. Das zeigen die Ergebnisse der erwähnten Studie. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wurde der Forschungsgegenstand der Studie auf alle Geschlechter und die sexuelle Orientierung ausgeweitet. Die Teilnehmenden wurden zu ihrer Betroffenheit und Erfahrungen während ihrer ganzen Dienstzeit ab Ende Rekrutenschule befragt.
Welches sind für dich die wichtigsten Resultate dieser Befragung?
Die Ergebnisse zeigen unter vielem anderen, dass von den befragten Armeeangehörigen knapp die Hälfte von Diskriminierung betroffen waren. Von den mehr als 1100 Interviewten haben 40 Prozent angegeben, sexualisierte Gewalt – verbal, nonverbal und körperlich – erlebt zu haben. Sexualisierte verbale Gewalt ist in unserer Armee leider am meisten verbreitet. Das ist nicht ok und wird nun an oberster Stelle moniert.
Wie wir aus einem DISPLAY-Portrait vor den Wahlen wissen, bist du jemand, der nicht mit der Federboa umherschleicht. Sind queere Anliegen wichtig für dich, oder setzt
du dich mehr für Menschen aus der Gesundheitsbranche ein?
Selbstverständlich sind mir die Anliegen von homo-, bi- und trans Menschen wichtig. Ich unterstütze die Community, wo ich kann. Als Pflegefachmann bin ich natürlich auch den Menschen im Gesundheitswesen sehr nahe und merke schnell, wo der Schuh drückt. Vor allem aber werde ich von vielen Menschen aktiv kontaktiert. Egal aus welchem Lager. Via Social Media oder E-Mails erreichen mich regelmässig Geschichten und Inputs. Das ist wichtig für einen Politiker.
Jemand, der dich sehr unterstützt hat im Wahlkampf, war dein Mann. Steht er dir immer noch beratend und unterstützend zur Seite?
Ja, er ist meine ganz grosse Stütze. Es gibt kaum Worte dafür, wie dankbar ich ihm dafür bin.
Hat sich eure Beziehung nach mittlerweile 19 Jahren irgendwie verändert, seit du Nationalrat bist?
Ja. Sie ist stärker geworden. Da er ebenfalls sehr politisch interessiert ist, hecken wir nicht mehr nur private, sondern auch politische Pläne zusammen aus.